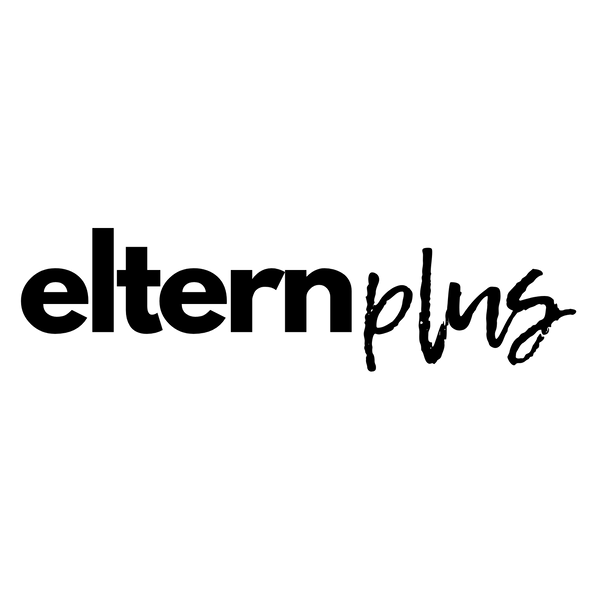Mangelnde Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften in Kitas bei der Erkennung von Krankheiten: Eine unterschätzte Herausforderung
Share
Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen (Kitas) tragen eine hohe Verantwortung. Sie fördern, betreuen und begleiten Kinder in ihrer Entwicklung. Doch ein oft übersehener Aspekt ihrer Arbeit ist die Fähigkeit, gesundheitliche Auffälligkeiten bei Kindern – und auch bei Kolleg*innen – frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren. Die Realität zeigt: In vielen Kitas fehlt es an entsprechenden Kompetenzen. Das hat Folgen – für Kinder, Teams und das gesamte System.
Warum die frühzeitige Erkennung von Krankheiten so wichtig ist
Krankheiten wie Autismus, ADHS, Sprachentwicklungsstörungen, aber auch psychische Belastungen oder körperliche Symptome wie Essstörungen oder chronische Erkrankungen treten oft schon im frühen Kindesalter auf. Früh erkannt, lassen sich viele dieser Herausforderungen besser begleiten. Auch bei Kolleg*innen können psychische Erkrankungen, Burnout oder Suchttendenzen das Kita-Geschehen beeinflussen – doch auch hier fehlt häufig das nötige Wissen zur sensiblen Wahrnehmung.
Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften: Der aktuelle Stand
Viele Fachkräfte fühlen sich unsicher im Umgang mit medizinischen oder psychischen Auffälligkeiten. Das liegt oft daran, dass die Ausbildung zumzur Erzieherin oder Kindheitspädagogin den Gesundheitsaspekt nur am Rande behandelt. Die Folgen: Symptome werden übersehen, Fehldeutungen entstehen, Gespräche mit Eltern oder Kolleginnen werden vermieden.
Fehlende Gesundheitsbildung in der Ausbildung
In vielen Bundesländern ist die Gesundheitsbildung kein zentraler Bestandteil der Erzieher*innenausbildung. Auch in Studiengängen der Kindheitspädagogik wird medizinisches oder psychologisches Wissen oft nur oberflächlich behandelt. Es fehlt an praxisnahen Modulen zur Krankheitserkennung, psychosozialer Beobachtung oder zur kollegialen Fallberatung bei gesundheitlichen Auffälligkeiten.
Erkennung von Krankheiten bei Kindern: Zwischen Bauchgefühl und Unsicherheit
Pädagogische Fachkräfte sind keine Ärzt*innen – und das ist auch nicht ihre Aufgabe. Dennoch verbringen sie täglich viele Stunden mit den Kindern und sind oft die ersten, die Verhaltensänderungen, körperliche Symptome oder emotionale Auffälligkeiten bemerken. Doch ohne fundiertes Wissen fehlen ihnen oft Kriterien, diese Beobachtungen einzuordnen und mit den Eltern professionell ins Gespräch zu gehen.
Kollegiale Beobachtung: Tabuthema Krankheit im Team
Nicht nur bei Kindern – auch im Team ist Krankheit oft ein Tabuthema. Ob anhaltende Erschöpfung, aggressives Verhalten, körperlicher Verfall oder Suchtverhalten – viele pädagogische Fachkräfte beobachten Veränderungen bei Kolleg*innen, trauen sich aber nicht, diese anzusprechen. Die Angst vor Konflikten, Loyalitätsgefühle oder Unsicherheit im Umgang verhindern oft eine offene Kommunikation.
Konsequenzen für Kindergesundheit und Teamdynamik
Wird eine kindliche Erkrankung nicht erkannt, kann sich dies negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken – vor allem bei psychischen Belastungen oder chronischen Krankheiten. Gleichzeitig führen nicht erkannte Belastungen im Team zu Überforderung, Spannungen und krankheitsbedingten Ausfällen. Das gesamte System gerät ins Wanken – auf dem Rücken der Kinder.
Was sich ändern muss: Ansätze und Perspektiven
Damit pädagogische Fachkräfte besser auf gesundheitliche Auffälligkeiten reagieren können, braucht es Veränderungen auf mehreren Ebenen:
-Curriculare Reformen in der Ausbildung: Mehr Gesundheitsbildung und psychosoziale Diagnostik
-Fortbildungen zu Themen wie Kinderkrankheiten, psychische Gesundheit, Gesprächsführung mit Eltern und kollegialer Beratung
-Kooperationen mit Gesundheitsfachkräften, z. B. Kinderärztinnen, Ergotherapeutinnen, Heilpädagog*innen
-Teaminterne Supervision und Fallbesprechungen
-Schulungen zu Selbstfürsorge und Resilienzförderung für Fachkräfte selbst
Fazit
Die mangelnde Kompetenz in der Erkennung von Krankheiten bei Kindern und im Team ist kein individuelles Versäumnis, sondern ein strukturelles Problem. Kita-Fachkräfte brauchen mehr Unterstützung, Wissen und Zeit, um dieser sensiblen Aufgabe gerecht zu werden. Nur so kann die Kita nicht nur Bildungs-, sondern auch ein gesundheitsfördernder Lebensort sein – für Kinder und für das Team.