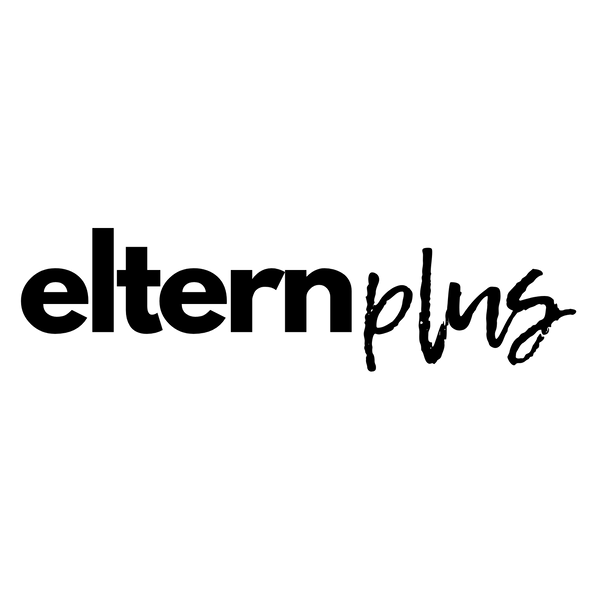Autismus in der Kita erkennen: Was Fachkräfte tun dürfen – und welche Rechte Eltern und Kinder haben
Share
Frühe Anzeichen ernst nehmen – aber sensibel bleiben
Viele Fachkräfte in Kindertagesstätten erleben im Alltag Kinder, die sich „anders“ verhalten: sie spielen lieber allein, vermeiden Blickkontakt, reagieren empfindlich auf Geräusche oder haben besondere Routinen. Nicht selten taucht dann leise der Gedanke auf: Könnte das Autismus sein?
Doch wie dürfen Erzieher*innen und pädagogische Fachkräfte mit solchen Beobachtungen umgehen? Was ist erlaubt, was nicht? Und welche Rechte haben Eltern und Kinder?
Wie erkennen Fachkräfte Anzeichen für Autismus in der Kita?
Autismus ist ein neurobiologisches Spektrum – das bedeutet: kein Kind ist wie das andere. Dennoch gibt es typische Verhaltensweisen, die früh auffallen können, z. B.:
-Wenig oder kein Blickkontakt
-Kaum Interesse an Kontakt zu anderen Kindern
-Starres Festhalten an Abläufen oder Objekten
-Sprachbesonderheiten oder verzögerte Sprachentwicklung
-Hohe Sensibilität für Geräusche, Berührungen oder Licht
-Schwierigkeiten im Wechsel von Aktivitäten
Diese Merkmale allein bedeuten nicht automatisch eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Sie können auch Teil anderer Entwicklungsphasen oder Eigenheiten sein.
Deshalb gilt: Fachkräfte beobachten über einen längeren Zeitraum und achten auf mehrere Auffälligkeiten in verschiedenen Situationen.
Was dürfen Fachkräfte tun – und was nicht?
Viele Eltern sind verunsichert, wenn Fachkräfte das Thema Autismus ansprechen. Wichtig ist hier: Es gibt klare pädagogische und rechtliche Grenzen.
Fachkräfte dürfen:
✅ Kinder aufmerksam beobachten
✅ Entwicklungen dokumentieren
✅ Beobachtungen in Entwicklungsgesprächen mitteilen
✅ Eltern mit Fingerspitzengefühl auf mögliche Besonderheiten hinweisen
✅ Vorschlagen, sich an Fachstellen zu wenden (z. B. SPZ, Frühförderung, Kinderarzt)
Fachkräfte dürfen nicht:
🚫 Eine Diagnose stellen – das ist ausschließlich medizinischem Personal vorbehalten
🚫 Eltern unter Druck setzen
🚫 Das Kind „anders“ behandeln, ohne vorherige Abklärung oder Einwilligung
🚫 Ohne Rücksprache mit den Eltern externe Stellen informieren
Wie gehen Fachkräfte vor, wenn ein Kind auffällig ist?
Beobachtung und Dokumentation
Die Fachkräfte nutzen Beobachtungsbögen, z. B. nach dem Infans-Konzept oder die Grenzsteinbeobachtung, um die Entwicklung in verschiedenen Bereichen sichtbar zu machen.
Teaminterne Beratung
Auffälligkeiten werden sensibel im pädagogischen Team oder mit der Leitung besprochen.
Elterngespräch
Fachkräfte laden zum Gespräch ein – offen, wertschätzend und ohne voreilige Schlussfolgerungen. Ziel ist, gemeinsam zu schauen, wie das Kind bestmöglich begleitet werden kann.
Vermittlung an Fachstellen
Wenn Eltern einverstanden sind, kann Kontakt zur Frühförderstelle, zum Kinderarzt oder zum Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) aufgenommen werden.
Welche Rechte haben Eltern und Kinder bei (Verdacht auf) Autismus?
🔹 Recht auf freie Entscheidung
Eltern entscheiden selbst, ob sie eine Diagnostik möchten. Niemand kann sie dazu zwingen.
🔹 Recht auf Teilhabe
Kinder mit (Verdacht auf) Autismus haben ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe in der Kita – mit individueller Förderung, wenn nötig.
🔹 Recht auf Inklusion
Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention gilt: Jedes Kind darf unabhängig von Diagnose oder Entwicklungsstand am Kita-Alltag teilnehmen.
🔹 Recht auf Schweigepflicht
Fachkräfte dürfen Informationen über das Kind nicht ohne Zustimmung der Eltern an Dritte weitergeben.
Was können Eltern tun, wenn sie unsicher sind?
Wenn Fachkräfte Sie als Eltern auf Auffälligkeiten ansprechen:
Hören Sie offen zu, ohne sich sofort zu sorgen oder angegriffen zu fühlen.
Stellen Sie Rückfragen: Was wurde genau beobachtet? In welchen Situationen?
Besprechen Sie Ihre Sicht: Sie kennen Ihr Kind am besten.
Lassen Sie sich beraten: Frühförderstellen, SPZ oder Kinderärzt*innen bieten neutrale, fachliche Einschätzungen.
Denken Sie in Chancen: Frühzeitige Förderung kann Ihrem Kind helfen, sein Potenzial besser zu entfalten.
Fazit: Beobachten ist keine Bewertung – sondern Fürsorge
Kinder mit Autismus erleben die Welt auf ihre ganz eigene Weise. Inklusion beginnt dort, wo Vielfalt erkannt und respektiert wird.
Fachkräfte dürfen keine Diagnosen stellen – aber sie dürfen beobachten, begleiten und unterstützen. Eltern wiederum haben das Recht, informiert zu werden und Entscheidungen in Ruhe zu treffen.
Gemeinsam kann ein gutes Netz entstehen – für Kinder, die ein bisschen anders sind, aber genauso dazugehören.
Tipp: Wenn Sie sich fragen, ob Ihr Kind autistische Züge zeigt oder eine besondere Begleitung braucht, können Sie erste Anlaufstellen wie die Frühförderstelle, das SPZ oder Autismustherapiezentren kontaktieren. Der erste Schritt beginnt oft mit einer ehrlichen, offenen Beobachtung – und einem wertschätzenden Miteinander.