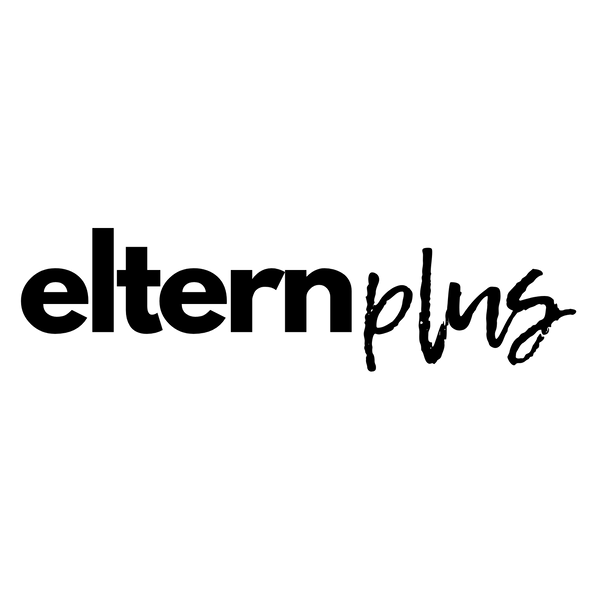Fehlende Barrierefreiheit in Kitas und pädagogischen Einrichtungen – ein strukturelles Problem
Share
Barrierefreiheit ist mehr als ein Aufzug oder eine Rampe. In Kindertageseinrichtungen und anderen pädagogischen Institutionen entscheidet sie darüber, wer teilhaben kann – und wer systematisch ausgeschlossen wird. Dennoch ist die Realität vieler Einrichtungen geprägt von baulichen, kommunikativen und sozialen Hürden. Kinder mit Behinderungen, Eltern mit nichtdeutscher Muttersprache, queere Familien oder neurodiverse Fachkräfte stoßen auf Hindernisse – und auf Strukturen, die nicht für alle mitgedacht wurden.
Was bedeutet Barrierefreiheit in der Pädagogik?
Barrierefreiheit bedeutet, dass alle Menschen ohne fremde Hilfe Zugang, Teilhabe und Selbstbestimmung erleben können – unabhängig von körperlichen, sprachlichen, kognitiven, sozialen oder kulturellen Voraussetzungen.
Im pädagogischen Kontext umfasst das:
-Bauliche Zugänglichkeit (z. B. für Rollstuhlnutzende)
-Leichte Sprache, visuelle Unterstützungen, Gebärden
-Flexible, individuelle Bildungsangebote
-Vorurteilsfreie Haltung gegenüber Diversität
-Inklusive Kommunikationsformen mit Familien
-Barrierearme Teamstrukturen und Arbeitsbedingungen
Wo Barrieren in Kitas beginnen – und oft ignoriert werden
Viele Kitas sind in Gebäuden untergebracht, die nicht barrierefrei geplant wurden:
-Kein Aufzug für mehrstöckige Einrichtungen
-Schmale Türen, fehlende barrierefreie Toiletten
-Unebene Wege oder steile Eingänge ohne Rampen
-Zu wenig Raum für Rollatoren, Assistenzgeräte oder Rückzugsplätze
-Unzureichende Akustik für Kinder mit Hörhilfen
Doch bauliche Barrieren sind nur die Spitze des Eisbergs.
Unsichtbare Barrieren: Sprache, Haltung und Strukturen
Barrierefreiheit scheitert oft nicht nur am Gebäude, sondern an Denkweisen:
-Eltern mit Sprachbarrieren erhalten keine mehrsprachigen Infos
-Kinder mit Autismus gelten als „zu speziell für den Alltag“
-Fachkräfte mit chronischen Erkrankungen stoßen auf Unverständnis
-Kinder mit kognitiven Besonderheiten werden als „nicht gruppenfähig“ aussortiert
-Projekte und Angebote richten sich an ein implizit „normales“ Kind
Diese unsichtbaren Barrieren führen zu Ausschlüssen, ohne dass sie als solche erkannt oder benannt werden.
Kinder, Eltern, Fachkräfte: Wer betroffen ist
Barrierefreiheit betrifft nicht nur Kinder mit Behinderungen. Auch andere Gruppen erleben strukturellen Ausschluss:
-Kinder mit Sprachverzögerungen oder Lernschwierigkeiten
-Eltern mit geringer Literalität, Fluchterfahrung oder Behinderung
-Regenbogenfamilien, alleinerziehende oder queere Eltern
-Fachkräfte mit psychischen Erkrankungen, Neurodivergenz oder körperlichen Einschränkungen
Ohne bewusste barrierefreie Gestaltung werden diese Gruppen übersehen oder stigmatisiert – was Chancengleichheit massiv einschränkt.
Rechtliche Grundlagen und ihre Umsetzungslücken
Deutschland hat mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zugesichert, dass inklusive Bildung und Barrierefreiheit gewährleistet werden. Auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 8a, § 22 SGB VIII) fordert Teilhabe für alle Kinder.
Trotzdem zeigen Studien und Erfahrungsberichte:
-Viele Einrichtungen ignorieren gesetzliche Vorgaben
-Träger investieren nicht ausreichend in barrierearme Umgestaltung
-Ausbildungen behandeln das Thema unzureichend
-Fachkräftemangel wird als Ausrede für Inklusionsverweigerung genutzt
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind da – es fehlt an Umsetzung, Haltung und Ressourcen.
Warum Inklusion Barrierefreiheit braucht
Inklusion ohne Barrierefreiheit ist nicht möglich. Wer will, dass Kinder in ihrer Vielfalt gemeinsam aufwachsen, lernen und sich entwickeln, muss Bedingungen schaffen, in denen alle Kinder gleichberechtigt mitmachen können – und niemand ständig kompensieren oder sich anpassen muss.
Barrierefreiheit bedeutet:
-Teilhabe ermöglichen statt Sonderlösungen schaffen
-Individuelle Bedürfnisse ernst nehmen, ohne zu pathologisieren
-Vielfalt gestalten, nicht sortieren
Lösungen: Was Träger und Teams jetzt tun können
-Barrieren systematisch erfassen: Gebäude, Sprache, Kommunikation, Haltung
-Fortbildungen zu Inklusion, Diversität und Barrierefreiheit verpflichtend anbieten
-Partizipation ernst nehmen: Betroffene Eltern, Kinder, Fachkräfte einbeziehen
-Informationsmaterial in einfacher und mehrsprachiger Sprache bereitstellen
-Barrierefreie Gestaltung bei Neubauten oder Umbauten konsequent mitplanen
-Fördermittel beantragen, z. B. über Inklusionsbudgets
-Kritische Reflexion im Team: Wer wird übersehen? Warum? Wie ändern wir das?
Fazit: Ohne Barrierefreiheit keine Chancengleichheit
Barrierefreiheit ist keine freiwillige Leistung – sie ist ein Menschenrecht. Pädagogische Einrichtungen, die Kinder begleiten, müssen so gestaltet sein, dass sie niemanden ausschließen, sondern alle mitdenken. Das geht nur, wenn wir wegkommen vom Normalitätsdenken und anfangen, Vielfalt wirklich zu leben. Denn jedes Kind hat das Recht, gesehen, verstanden und unterstützt zu werden – ohne Hürden, ohne Ausnahmen.