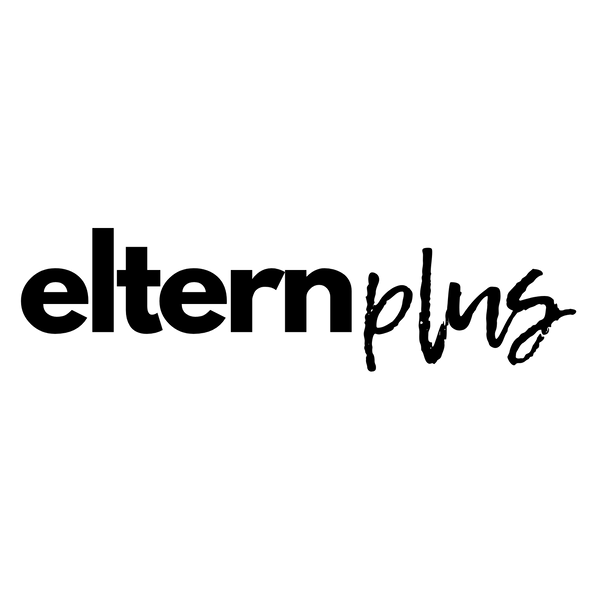Adultismus in der Kita: Wenn Erwachsene zu viel bestimmen – und Kinder zu wenig mitgestalten
Share
Kindertageseinrichtungen gelten als Orte der Partizipation, Förderung und kindzentrierten Bildung. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: In vielen Projekten, Angeboten und Aufführungen dominieren nach wie vor die Vorstellungen der Erwachsenen. Kinder werden oft in vorgefertigte Rollen gedrängt, statt selbstbestimmt mitzugestalten. Adultismus, also die Machtüberlegenheit Erwachsener gegenüber Kindern, spielt dabei eine zentrale Rolle – meist unbewusst.
Was ist Adultismus?
Adultismus beschreibt eine diskriminierende Haltung gegenüber Kindern, die sich aus dem Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern ergibt. Dabei werden kindliche Perspektiven, Bedürfnisse oder Ideen nicht ernst genommen, übergangen oder gar abgewertet – zugunsten „pädagogisch wertvoller“ oder „ästhetisch ansprechender“ Erwachsenenvorstellungen.
Adultismus ist kein individuelles Fehlverhalten, sondern tief in vielen Strukturen des Kita-Alltags verankert – gerade auch in Projekten.
Adultistische Strukturen in Kita-Projekten erkennen
In der Projektarbeit zeigt sich Adultismus z. B. so:
-Themen werden ohne Mitbestimmung der Kinder vorgegeben
-Inhalte orientieren sich an Wünschen oder Erwartungen der Eltern/Träger
-Zeitrahmen und Abläufe werden nicht kindgerecht gestaltet
-Kinder werden zu bestimmten Rollen gedrängt, z. B. für eine Theateraufführung
-Der Fokus liegt auf Ergebnisorientierung statt Prozessqualität
Die eigentliche Idee von Projektarbeit – die Beteiligung der Kinder – wird damit oft konterkariert.
Typische adultistische Muster bei Aufführungen und Angeboten
Ein besonders anschauliches Beispiel für adultistische Gestaltung ist die Vorbereitung von Aufführungen, Feiern oder Elternabenden. Häufig passiert dabei Folgendes:
-Die Erzieher*innen wählen das Thema, schreiben das „Drehbuch“ und teilen Rollen zu
-Kinder sollen Gedichte aufsagen, Lieder singen oder Tänze aufführen, die nicht aus ihrer Lebenswelt stammen
-Das Hauptziel ist ein „schönes Ergebnis“ für die Eltern – nicht der Prozess, in dem Kinder sich einbringen können
-Unsichere, zurückhaltende Kinder werden überredet oder gedrängt, mitzuwirken
Dabei entsteht oft ein Bild von Bildung, das Kindern wenig zutraut – und vor allem Erwachsene zufriedenstellen soll.
Die Folgen: Kinder werden zu Statisten
Wenn Kinder in Projekten kaum mitbestimmen dürfen, führt das zu:
-Weniger Selbstwirksamkeit und Beteiligung
-Frustration, Langeweile oder Rückzug
-Rollenstereotype und Leistungsdruck, z. B. beim „schönen Auftritt“
-Kindern wird vermittelt, dass ihre Ideen und Gefühle zweitrangig sind
So wird die Chance vertan, Kinder als kompetente Akteur*innen ernst zu nehmen – was dem pädagogischen Auftrag widerspricht.
Beteiligung statt Bevormundung: Ein Perspektivwechsel
Ein bewusster Umgang mit Adultismus bedeutet, die Perspektive der Kinder konsequent einzubeziehen:
-Projekte entstehen aus den Themen der Kinder
Erzieherinnen verstehen sich als **Begleiterinnen**, nicht als Regisseur*innen
-Aufführungen dürfen authentisch, unperfekt und offen sein
-Angebote sind wahlfrei, flexibel und kindgerecht
Es geht nicht darum, Kindern alles zu überlassen – sondern ihnen echte Mitbestimmung auf Augenhöhe zu ermöglichen.
Gute Projektarbeit braucht Mitbestimmung
Partizipative Projektarbeit bedeutet:
-Kinder wählen Themen, Rollen und Materialien mit aus
-Zeit und Raum passen sich kindlichen Bedürfnissen an
-Erwachsene stellen Fragen statt Vorgaben
-Prozesse stehen im Mittelpunkt, nicht das perfekte Ergebnis
-Reflexion gehört dazu: Was war für die Kinder wichtig? Was wollen sie anders?
So entstehen Projekte, die bedeutsam, lebendig und kindgerecht sind – und die echte Bildungsprozesse anstoßen.
Fazit
Adultismus in der Kita zeigt sich oft dort, wo Erwachsene das Sagen haben – und Kinder sich anpassen müssen. Gerade in der Projektgestaltung lohnt es sich, die eigene Haltung kritisch zu hinterfragen: Dürfen Kinder mitentscheiden, mitgestalten, mitwirken? Oder erfüllen sie nur Erwartungen von außen?
Wer Kinder ernst nimmt, muss ihnen Raum geben – für eigene Ideen, Entscheidungen und Ausdrucksformen. Nur so wird die Kita zum Ort gelebter Demokratie und echter Teilhabe.